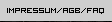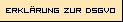Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin e.V.
Warum das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) aus
suchtmedizinischer Sicht auf den Prüfstand gehörtZur Diskussion gestellt vom Vorstand der DGS –
Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin
Ein Gesetz aus einer anderen ZeitAls 1971 das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) verabschiedet wurde, waren
Gesetzgeber und Experten der Meinung, mit dem Strafrecht könne man der
aufkommenden „Drogenwelle“ Herr werden. Ein furchtbarer Irrtum: Im folgenden
Jahrzehnt verhinderte eben dieses BtMG eine rasche und pragmatische Antwort
auf die rasante Ausbreitung des AIDS-Virus unter den Heroinabhängigen, weil
Substitution verboten war und das Prinzip der Schadensminderung in Deutschland
offiziell nicht anerkannt war.
Zu dieser Zeit grenzte auch die Psychiatrie Suchtkranke und insbesondere
Drogenabhängige weitgehend aus, selbst noch in der ersten Phase der
Psychiatriereform; erst mit den Empfehlungen der Expertenkommission im Jahre
1988 wurde diese Fehlentwicklung als fatal erkannt und unter Bezugnahme auf
die internationalen Erfahrungen mit der Substitutionsbehandlung, mit harm
reduction orientierten Ansätzen und mit den Erfahrungen der AIDS-Hilfe
Kurskorrekturen gefordert und schrittweise umgesetzt (u.a. Aufbau des
Suchtausschusses der BDK, Stationen zur qualifizierten Entzugsbehandlung,
Behandlungsangebote für psychiatrisch komorbide Drogenabhängige, chronisch
mehrfach abhängige Patienten und aufsuchende Hilfen).
Bereits während der Debatte um das BtMG Anfang der 1970er Jahre gab es
Stimmen, die eine rein strafrechtliche Würdigung des Drogenproblems für wenig
hilfreich hielten. Diese Befürchtungen bewahrheiteten sich: 1982 wurde deshalb
der Abschnitt über „Therapie statt Strafe“ nachträglich in das Gesetz
eingefügt. Eine Regelung allerdings, die Richter entscheiden lässt, ob der
Aufenthalt in einer Therapieeinrichtung hilfreicher erscheint als der in einer
Haftanstalt.
Auch die weiteren Änderungen und Anpassungen, 2014 aufgelistet von der
Bundesregierung in der Bundestagsdrucksache 18/2937 (im folgenden in kursiv
zitiert), sind der Entwicklung immer hinterhergelaufen und haben nur punktuell
Abhilfe geschaffen, einige der Regelungen werden von Landesregierungen sogar
boykottiert:
● Die Einrichtung von Drogenkonsumräumen (§ 10a BtMG): Die bayerische
Landesregierung verweigert beispielsweise der Stadt Nürnberg einen Konsumraum
und nimmt die vergleichsweise hohe Zahl an Drogentoten dort in Kauf.
● Die ärztliche Substitutionsbehandlung für Opiatabhängige mit der
Möglichkeit zu einer psychosozialen Betreuung (§ 13 BtMG i. V. m. § 5 BtMVV):
Die seit Jahren bekannte unsichere Rechtslage für Substitutionsärzte führt
geradewegs in eine Unterversorgung, Substitutionsärzte stehen weiterhin mit
einem Bein im Gefängnis.
● Die diamorphingestützte Substitutionsbehandlung für Schwerstabhängige: Nach
Abschluss der wissenschaftlichen Untersuchung und Überführung der Behandlung
mit Diamorphin (Heroin) in die Regelversorgung wurden gerade zwei neue
Ambulanzen eröffnet, weil für die Patienten viel zu scharfe
Zulassungsbedingungen gelten und weil die gesetzlichen Auflagen mit den daraus
entstehenden Kosten selbst bereitwillige Kommunen und potentielle Träger vor
der Einrichtung von Ambulanzen und Schwerpunktpraxen zurückschrecken lassen.
● Die ausdrückliche Möglichkeit der Vergabe von Einmalspritzen und
öffentlichen Informationen hierüber (§ 29 Absatz 1 Satz 2 BtMG): Diese
Regelung gilt allerdings nicht für Haftanstalten, wo die höchsten Risiken für
die Übertragung von HIV und Hepatitis bestehen.
● Das Prinzip der Hilfe statt Strafe (Absehen von der Verfolgung, § 31a
BtMG): seit 1994 haben Bund und Länder es nicht geschafft, den Auftrag des
Bundesverfassungsgerichts umzusetzen, einheitliche Obergrenzen des Besitzes
von Cannabis festzulegen, bis zu denen Verfahren eingestellt werden können.
● Verschiedene Frühinterventionsmodelle (§§ 31a und 37 BtMG): Zu nennen ist
insbesondere das Frühinterventionsmodell FreD, das zu Drogenberatung anstelle
von Strafe verhelfen soll. Jedoch sind viele Voraussetzungen misslich:
1. Das Modell gilt nur bei geringen Cannabismengen. Es ist nicht einzusehen,
weshalb ein Konsument mit 6 Gramm Cannabis der Beratung bedarf, der mit 9 oder
11 Gramm erwischte Konsument angeblich Strafe statt Beratung oder Behandlung
bedarf.
2. Was eine geringe Cannabismenge bedeutet, wird in den Bundesländern
unterschiedlich definiert.
3. Das Modell heißt FreD, weil es nur für erstauffällige Drogenkonsumenten
gilt (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten). Nur benötigen
gerade Wiederholungs-Konsumenten und Dauerkonsumenten erst recht eine Beratung
oder Behandlung.
4. Es gibt Bundesländer, in denen FreD häufig, wenig oder gar nicht angewandt
wird.
Und der § 37 BtMG wird überhaupt selten angewandt.
● Das Prinzip der Therapie statt Strafe (Zurückstellen der Strafvollstreckung
für betäubungsmittelabhängige Straftäter, §§ 35 ff. BtMG): Die Zahl der
„35er-Urteile“ nimmt seit Jahren kontinuierlich ab, weil mit Zulassung der
Substitutionsbehandlung die Beschaffungskriminalität rapide abgenommen hat.
Stattdessen steigen die Verurteilungen nach §64 StGB, d.h. Unterbringung in
einer geschlossenen psychiatrisch-drogentherapeutischen Einrichtung - mit der
Begleiterscheinung, dass nur in wenigen geschlossenen forensischen Abteilungen
Substitutionsbehandlung angeboten werden.
Das generalpräventive Ziel des BtMG, den Missbrauch von Betäubungsmitteln
sowie das Entstehen oder Erhalten einer Betäubungsmittelabhängigkeit soweit
wie möglich auszuschließen, ist verfehlt worden. Seit 1971 haben der
BtM-Konsum und die BtMAbhängigkeit in damals unvorstellbarer Weise zugenommen
und besonders in der Gruppe der Heroinabhängigen zu dramatischen
Gesundheitsrisiken geführt. Das BtMG hat nicht nur sein Ziel verfehlt, sondern
verhindert weiterhin sogar schadensbegrenzende Maßnahmen.
Das BtMG war von Anfang an eine Fehlkonstruktion und auch die Anpassungen seit
1971 haben es nur punktuell verbessert: Keine der seitdem aufgetretenen
„Drogenwellen“ ist durch das Gesetz ernsthaft beeinflusst worden.
Strafandrohungen haben zu verschiedenen Zeiten Konsumenten nicht in
nennenswertem Umfang davor zurückschrecken lassen, Cannabis, Ecstasy, Heroin,
Kokain/Crack und aktuell Methamphetamin (Crystal) zu nehmen. Das BtMG in
seiner jetzigen Fassung trifft in allererster Linie die Konsumenten und
bereitet den Boden für ein brutales, milliardenschweres, kriminelles Geschäft
mit internationalen Verflechtungen, teilweise auch zu terroristischen
Gruppierungen.
Strafandrohungen haben aber nicht nur in der Gruppe der Heroinabhängigen
Schaden angerichtet. Strafandrohungen und allgemein das repressive Element
stehen nach wie vor im Verhältnis zu den drei anderen Säulen einer modernen
Drogenpolitik: Prävention, Schadensminderung („harm reduction“) und Therapie
zu sehr im Vordergrund; und ein Großteil der Ressourcen im Umgang mit der
Sucht werden durch Kosten bei Polizei, Justiz und im Strafvollzug verbraucht.
Diese Gewichtung steht den Zielen einer modernen public-health-Politik
entgegen und drängt Konsumenten, die sich schlimmstenfalls nur selbst
schädigen, in die Illegalität, was sie für Vorbeugung, Schadensbegrenzung und
Therapie schlecht erreichbar macht.
Fast die Hälfte der deutschen Strafrechtsprofessoren und der langjährige
Kommentator des BtMG sprechen sich für eine Überprüfung des Gesetzes aus und
auch aus den Reihen der Polizei werden seit langem Zweifel an der
Sinnhaftigkeit der bestehenden Regelungen geäußert.
Das bestehende Betäubungsmittelrecht hat die Entwicklungen in der Suchtmedizin
und -therapie nicht oder nicht ausreichend aufgenommen und stellt sich als
hinderlich und problemverschärfend dar.
Es ist deshalb auch aus suchtmedizinischer Sicht dringend geboten, das BtMG
gründlich zu überprüfen.
1. Schadensminderung ernst nehmen
Seit Inkrafttreten des BtMG 1971 wurde die Drogenpolitik um das Prinzip der
Schadensminderung erweitert: Bis in die 1990er Jahre galt der Leitsatz,
Süchtige so weit fallen zu lassen, bis ihr „Leidensdruck“ sie zur Umkehr
bekehrt. Selbst die Abgabe von Spritzen und Nadeln an Heroinabhängige galt
lange als strafbewehrte Förderung des Rauschgiftkonsums. Schadensminderung
wird von der WHO empfohlen für den Umgang mit legalen wie illegalen
Substanzen: Plastikbecher statt Bierflaschen in Fußballstadien sind ein
Beispiel dafür, Grenzwerte bei Tabakprodukten ein anderes, Regeln zum
Höchsteinsatz an Spielautomaten ein drittes. Der Gesetzgeber in Deutschland
verweigert jedoch bei illegalen Substanzen überfällige Schritte mit dem
Hinweis, das sei nach dem BtMG nicht erlaubt: drug-checking beispielsweise
oder auch Pilotprojekte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis.
2. Das Abstinenzdogma ist gefallen
Von einer weiteren „ewigen Wahrheit“ hat sich die Suchtmedizin bereits vor
über 20 Jahren verabschiedet: Die dauerhafte Abstinenz von Suchtmitteln als
einzig relevantes und alle anderen Belange nachordnendes Behandlungsziel ist
einer wesentlich differenzierteren und realitätsorientierten Zielhierarchie
gewichen. In der Folge haben sich individualisierte Therapien wie
„kontrolliertes Trinken“ und Substitutionsbehandlung etabliert. In dieser
Zielhierarchie steht die stabile Abstinenz heute nach der Sicherung des
möglichst gesunden Überlebens, der Reduzierung des Konsums und der
Verlängerung abstinenter Perioden nicht mehr an erster Stelle. Das
Abstinenzdogma war die suchtmedizinisch-wissenschaftliche Grundlage für die
kompromisslose Ausrichtung des Gesetzes – deshalb ist der Gesetzgeber gut
beraten, das BtMG zu überprüfen.
3. Das BtMG erschwert Prävention, Schadensminderung und Therapie
Drogenkonsumenten sind vor dem Gesetz immer Kriminelle, weil zwar der Konsum
straffrei ist, hingegen Erwerb und Besitz verboten sind. Dieses Stigma
erschwert ihnen den Zugang zum Drogenhilfesystem. Lebensrettende Behandlungen
wiederum erreichen Drogenkonsumenten häufig zu spät: Ihr illegaler Status
verhindert bei Überdosierungen/Vergiftungen nicht selten, dass Mitkonsumenten
umgehend medizinische Hilfe anfordern, da sie polizeiliche Ermittlungen
fürchten. Die Schweiz, die Niederlande und auch Portugal haben nachgewiesen,
dass mit einer Entkriminalisierung Begleit- und Folgekrankheiten zurückgehen
und insgesamt der Konsum nicht zunimmt.
4. Bei Neuen Psychoaktiven Substanzen kennt das BtMG nur Verbote
„Neue Psychoaktive Substanzen“ mit unbekannter Wirkung stellen Notfallmedizin
und Drogenhilfe vor neue Probleme. Es ist richtig, diese Substanzen in die
Verbotslisten des BtMG aufzunehmen. Zusätzlich muss „drug-checking“ gesetzlich
abgesichert werden, um extrem gefährliche Stoffe frühzeitig erkennen zu
können. Drogen straffrei auf ihre Zusammensetzung überprüfen lassen zu können,
hat sich in Österreich, in der Schweiz und in den Niederlanden bewährt und den
Konsum letztlich nicht gefördert.
5. Das BtMG erzeugt vermeidbare Kosten
Die Strafverfolgung von Konsumenten illegaler Substanzen bindet personelle und
finanzielle Ressourcen bei Polizei und Justiz selbst bei der Einstellung von
Verfahren, da jeder einzelne Fall erst einmal durchermittelt werden muss. Auch
aus medizinischer Sicht bewirkt das BtMG vermeidbare Kosten: beispielsweise
durch drogenassoziierte Begleitkrankheiten wie AIDS und Hepatitis oder auch
durch Vergiftungen und Überdosierungen.
6. Sonderfall Cannabis als Medizin
Das BtMG hat die Erforschung medizinischer Eigenschaften des Hanfs mehrere
Jahrzehnte lang behindert. Das Spektrum der Indikationen wird aber aktuell
immer interessanter. Ein wachsender Kreis von Menschen, die nicht zu den
herkömmlichen hedonistischen Cannabiskonsumenten zählen, erlebt diese Substanz
als hilfreich, beispielsweise bei der Linderung von Schmerzen. Das BtMG trägt
dieser Entwicklung nicht in gebotenem Umfang Rechnung und erklärt potentielle
Patienten zu Kriminellen.
7. Der §29 im BtMG macht aus Ärzten Dealer
Aus suchtmedizinischer Sicht muss im BtMG der Paragraph 29 geändert werden,
der substituierende Ärzte bedroht, sie bei Mitgabe von Medikamenten wie Dealer
zu verfolgen. Und die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV), gehört
aus medizinischen, rechtlichen und drogenpolitischen Gründen gründlich
reformiert, da die aktuelle Version die Substitutionsbehandlung behindert und
Ärzte davon abhält, Opioidabhängige zu behandeln.
Für den Vorstand der DGS: Prof. Dr. Markus Backmund (München) Hans-Günter
Meyer-Thompson (Hamburg) 15.02.2015