Unbeantwortete Themen | Aktive Themen
Schliessung des Forums: Das Forum wurde mangels Beteiligung zum 31.12.2019 eingefroren und dient künftig als Nachschlagewerk.
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unser Nachbarforum.
Das Forumsteam
P.S. In liebevoller Erinnerung an den verstorbenen Gründer des Forums Friedrich Kreuzeder (Federico), hier noch ein Video.
| Autor |
Nachricht |
|
Federico
|
Betreff des Beitrags: Traumata – Angst – Alkoholsucht  Verfasst: Verfasst: Dienstag 9. Februar 2010, 21:32 |
|
 |
| Gründer † |
 |
Registriert: Freitag 27. November 2009, 17:11
Beiträge: 8253
Wohnort: München
|
|
[size=150]Frühe Traumata: Hohes Risiko für Alkoholsucht [/size]
Eine in der Kindheit durchlebte hohe psychische Belastung kann beim erwachsenen Menschen den Alkoholismus födern. Wie Wissenschaftler heraus fanden, ist das Risiko alkoholabhängig zu werden dreimal so hoch.
Nach einer im Rahmen eines Symposiums zur Suchtmedizin vorgestellten Studie, ist erwiesen, dass frühe Traumata das Risiko von Alkoholsucht erhöhen. Neben Experten der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) haben Psychologen und Suchtmediziner aus ganz Deutschland zum Thema "Trauma und Sucht" referiert.
Zwischen zehn und 50 Prozent der Menschen, die ein traumatisches Erlebnis hatten, entwickeln direkt oder mit einer Verzögerung von bis zu einem halben Jahr eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder eine andere psychische Störung, wie etwa Depressionen und Angstzustände. "Heute wissen wir, dass manche Ereignisse häufiger eine posttraumatische Belastungsstörung zur Folge haben als andere: Vergewaltigungen zu 50 Prozent, Verkehrsunfälle lediglich in zehn bis 20 Prozent der Fälle", so Martin Driessen vom Zentrum für Psychiatrie und Psycho-therapeutische Medizin, Krankenanstalten Gilead in Bethel.
Der Mehrzahl der Betroffenen könne mit psycho-therapeutischen Interventionen geholfen werden. Komplizierter sei die Situation, wenn nicht nur einmalige, so genannte Typ-1-Traumata, sondern lebensgeschichtlich frühe, wiederholte, anhaltende und/oder komplexe Traumatisierungen wie sexueller Missbrauch vorliegen (Typ 2). Dann kommt es zu lang anhaltenden und tief greifenden Störungsmustern. Der Experte betont jedoch, dass es sich bei traumatischen Ereignissen grundsätzlich um existenziell bedeutsame Ereignisse handelt, die bei fast jedem Menschen Angst und Schrecken sowie das Gefühl des Bedrohtseins auslösen.
Studien mit Alkoholabhängigen sprechen für eine hohe Rate psychischer Traumatisierungen in dieser Gruppe. Die US-Wissenschaftler um Kenneth Kendler hatten in einer vor wenigen Jahren veröffentlichten Studie gezeigt, dass traumatische Erfahrungen in der Kindheit und Jugend das Risiko einer späteren Abhängigkeitserkrankung um das Dreifache erhöhen, bei schwerer sexueller Traumatisierung sogar um den Faktor 5,7. Erste psychologische und neurobiologische Ansätze zum Verständnis des Zusammenhangs von Trauma und Sucht werden diskutiert, bleiben aber noch im spekulativen Bereich. In Europa beschäftigt sich insbesondere eine Amsterdamer Forschergruppe um Wim van den Brink mit Fragen der klinischen Bedeutung traumatischer Erfahrungen bei Abhängigen.
Willemien Langeland vom Institut für Suchtforschung der Freien Universität Amsterdam berichtet, dass Auswertungen von Studien unter Alkoholikern ergeben haben, dass körperliche sowie seelische Übergriffe in der Kindheit sowohl bei Frauen als auch bei Männern eine spätere Alkoholabhängigkeit zu begünstigen scheinen. Auch Begleiterkrankungen wie Angstzustände treten häufiger auf. Bei Frauen, die sexuell missbraucht wurden, ist der Krankheitsverlauf sogar deutlich schwerer. Langeland plädiert daher dafür, in Zukunft stärker als bisher Alkoholabhängige immer auch daraufhin zu untersuchen, ob Traumatisierungen vorliegen.
WANC 02.06.04/pte
_________________
„Es gibt keine Alternative zum Optimismus,
Pessimismus ist Lebensfeigheit.“ Richard David Precht
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
danilo
|
Betreff des Beitrags: Meine Liebliengstante  Verfasst: Verfasst: Donnerstag 11. Februar 2010, 01:13 |
|
Registriert: Freitag 18. Dezember 2009, 19:28
Beiträge: 98
Wohnort: Schweiz
|
|
Danke Federico für diesen sensiblen Aufstatz. Ich verlor meine Tante, ich war unschuldige 4 Jahre alt, vor rund 40 Jahren. Die Wunde war und ist dermassen tief, noch heute habe ich von ihr ein Originalgemälde in meinem Schlafzimmer. Sie hat uns verlassen nach einem tragischen Autounfall, hätte es damals banale Gurte gegeben oder Airbags, sie wäre noch fröhlich unter uns. Es war eine Nacht wie heute, hinterhältiges Glatteis, kalt, unberechenbar. Mit läppischen 20 km/h ist sie gegen eine Leitplanke geknallt, heute würden wir amüsiert aussteigen und völlig unverletzt ein Taxi rufen. Die Lenkradstange wurde ihr leider zum Verhängnis. (Opel Taunus Jg. 68.) Vierzig Jahre später bilde ich mir ein, immer noch unter diesem Trauma zu leiden. Sie war so was wie meine zweite Mutter.
Dani
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
Federico
|
Betreff des Beitrags:  Verfasst: Verfasst: Donnerstag 11. Februar 2010, 13:02 |
|
 |
| Gründer † |
 |
Registriert: Freitag 27. November 2009, 17:11
Beiträge: 8253
Wohnort: München
|
|
@Danilo,
da Dich das Thema zu interessieren scheint, hier eine kurze Zusammenfassung meiner bisherigen Erkenntnisse. Die Auswirkungen einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), sind seit langem bekannt. Substanzmissbrauch aber auch Borderline, Bulimie, Anorexie sind überdurchschnittlich oft darauf zurückzuführen.
Mittlerweile gibt es sehr gute neue Therapieansätze, resultierend aus diesen Erkenntnissen. Diese neuen Therapiemethoden werden weder von den Krankenkassen noch von der Rentenversicherung bezahlt, da die Therapie „Abstinenz“ nicht mehr in den Vordergrund stellt. Wenn ich es richtig verstehe, ist die Forderung nach „Abstinenz“ eine Hürde, die ein traumatisierter Patient nicht nehmen kann oder will. Langfristig könnte allerdings eine derartige Therapie in der Folge, bei sehr vielen Patienten zur Abstinenz (aus innerer Einsicht) aus sich selbst entwickelt führen. Wie gesagt, so habe ich es verstanden.
Hierzu eine Buchrezession:
Posttraumatische Belastungsstörung und Substanzmissbrauch
Das Therapieprogramm "Sicherheit finden"
Autor: Lisa M. Najavits (deutsche Übersetzung und Bearbeitung von Ingo Schäfer, Martina Stubenvoll und Anne Dilling)
Verlag: Hogrefe Verlag 2008, ISBN 978-8017-2127-5, 370 S., 59,90 Euro
Sehr viele Suchtkranke sind Opfer von traumatischen Erfahrungen.
Zu dieser Erkenntnis kommt nicht nur eine Vielzahl
von Studien – auch und besonders SuchttherapeutInnen
finden den Zusammenhang "Trauma und Sucht" in ihrer
täglichen Arbeit. Häufig berichten Betroffene von Traumatisierung
bereits in der Kindheit durch körperlichen und sexuellen
Missbrauch und auch im Verlauf der Sucht besteht ein
stark erhöhtes Risiko für eine (Re-) Traumatisierung, z.B.
im Rahmen von Beschaffungskriminalität, Prostitution und
Obdachlosigkeit. Entsprechend häufig ist die Posttraumatische
Belastungsstörung (PTBS): abhängig von Geschlecht
und konsumierten Substanzen finden sich Prävalenzen von
bis zu 34%.
Es ist unstrittig, dass im Rahmen einer Suchtbehandlung
komorbide Störungen zeitgleich und integriert mit behandelt
werden sollten. Gerade bei der Therapie von komorbiden
Traumafolgestörungen bestand jedoch lange die Schwierigkeit,
dass die verfügbaren und erprobten Therapieansätze
fast immer die Konfrontation mit den Traumatisierungen
(i.d.R. in sensu Exposition zur kognitiven Integration und
Bewältigung des Erlebten) in den Mittelpunkt stellen. Hierfür
aber ist eine psychische, körperliche und soziale Stabilität
vonnöten, die ein erheblicher Teil der Suchtkranken in Behandlung
noch nicht mitbringt.
Mit dem Therapieprogramm "Sicherheit finden" liegt nun
auch für den deutschen Sprachraum ein Behandlungsmanual
vor, bei dem dieser Widerspruch nicht besteht und das sich
daher besonders für die therapeutische Arbeit mit schwer
belasteten, traumatisierten Suchtkranken eignet.
Das kognitiv-verhaltenstherapeutische Programm wurde von
der Autorin Lisa M. Najavits an der Universität Harvard
entwickelt und im englischen Original mit dem Titel "Seeking
Safety" veröffentlicht. Es findet in den USA seit Jahren
Anwendung und wurde dort in umfassenden Untersuchungen
erprobt, die seine Wirksamkeit bestätigten.
"Sicherheit finden" verfolgt mit seinem explizit Ressourcen-
orientierten Ansatz vorrangig das Ziel, Stabilität und
Sicherheit im Leben von traumatisierten Suchtkranken zu
implementieren. Traumatisierungen werden im Rahmen der
Therapie nicht im Detail besprochen und durchgearbeitet,
sondern die Behandlung zielt darauf ab, die Folgen dieser
Erfahrungen besser zu verstehen und "sichere Bewältigungsstrategien"
zu erlernen. Diese ermöglichen es im Laufe der
Therapie, auf Substanzkonsum und andere "unsichere" Verhaltensweisen
(wie z.B. Risikoreiches Verhalten in Beziehungen
oder Krankheiten unbehandelt zu lassen) zu verzichten.
Nach einer ausführlichen Einführung für TherapeutInnen,
die u.a. die Grundhaltung und die Prinzipien des Programms
erläutert und begründet (bspw. Sicherheit als oberstes Ziel,
integrierte Behandlung von Sucht und PTBS, Schwerpunkt
auf Idealen und Zielen), werden in Form von 25 Sitzungen
verschiedene zu bearbeitende Themen beschrieben. Diese
können entweder in Form einer Art Curriculum in der Gruppe
bearbeitet oder aber auch voneinander unabhängig in Gruppen
oder Einzelsettings eingesetzt werden. Für jede Sitzung
gibt es eine Auswahl an passenden Arbeitsmaterialien für
TherapeutInnen und PatientInnen. Das Programm ist daher
ohne großen Planungs- und Konzeptionsaufwand in verschiedenen
Settings, auch von Personal ohne traumatherapeutische
Zusatzausbildung durchführbar.
Obwohl das Manual ursprünglich für Personen mit der Doppeldiagnose
PTBS und Sucht entwickelt wurde, eignet es
sich auch für Personen, die unter einer subsyndromalen PTBS
oder unter weiteren komplexen Traumafolgestörungen leiden.
Der Behandlungsansatz wurde als Gruppenangebot
konzipiert, kann jedoch auch in der Einzeltherapie eingesetzt
und in diesem Fall auch mit Expositionselementen kombiniert
werden.
Ein besonderes Merkmal von "Sicherheit finden" ist die Betonung
humanistischer Themen, was sich in den Inhalten vieler
Sitzungen abbildet, die Werte wie "Verbindlichkeit", "Anteilnahme",
"Ehrlichkeit" und "Achtsamkeit" behandeln.
Hintergrund dessen ist, dass sowohl Traumatisierungen als
auch Sucht und besonders deren Kombination häufig zu einer
veränderten Sicht von der Welt, zu Resignation und dem
Verlust von "Idealen" führen. Die Auseinandersetzung mit
grundlegenden Werten soll auf ihre Weise dazu beitragen,
Betroffene zu motivieren und ihnen einen sorgsameren Umgang
mit sich selbst nahe zu bringen.
Insgesamt stellt das Programm "Sicherheit finden" eine seit
langem notwendige Ergänzung zu den derzeit im deutschen
Suchthilfesystem verfügbaren und erprobten Therapieansätzen
dar. Nicht zuletzt kann es gerade aufgrund der Betonung
einer ganzheitlichen Sicht und der durchgängig optimistischen,
heilungsbetonenden Grundhaltung die Suchttherapie
allgemein und die Versorgung von traumatisierten
Suchtpatienten im besonderen hierzulande sehr bereichern
und effektivieren.
Dr. Sybille Zumbeck
Gr. Offenseth-Aspern
Quelle: Suchtmed 11 (4) 140 (2009)© ecomed Medizin, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Landsberg
Im Anhang zum Download:
[size=150]Sicherheit finden - ein Therapieprogramm
bei PTBS und Substanzmissbrauch[/size]
Dr. med. Ingo Schäfer, MPH
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung
(ZIS) der Universität Hamburg
| Dateianhänge: |
 Schaefer.pdf [866.59 KiB]
Schaefer.pdf [866.59 KiB]
851-mal heruntergeladen
|
_________________
„Es gibt keine Alternative zum Optimismus,
Pessimismus ist Lebensfeigheit.“ Richard David Precht
Zuletzt geändert von Federico am Donnerstag 11. Februar 2010, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
elgarlopin
|
Betreff des Beitrags: PTBS und Sucht  Verfasst: Verfasst: Donnerstag 11. Februar 2010, 16:31 |
|
Registriert: Samstag 26. Dezember 2009, 17:34
Beiträge: 275
Wohnort: Hamburg
|
|
Hallo,
sehr interessiert habe ich das posting gelesen.
Dann wollte ich den Anhang herunterladen, aber der war schon nach ca. 3-4 Std. verschwunden!
Ist der Text sonstwie irgendwie zugänglich, ohne das Buch zu kaufen?
MfG elgarlopin
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
anima
|
Betreff des Beitrags:  Verfasst: Verfasst: Samstag 20. März 2010, 09:26 |
|
Registriert: Freitag 19. März 2010, 12:20
Beiträge: 119
|
|
@Danilo, darf ich die Frage stellen, was denn mit Deiner biologischen Mutter ist? Wenn es zu privat ist, nehme ich die Frage zurück....
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
Archi
|
Betreff des Beitrags:  Verfasst: Verfasst: Dienstag 23. März 2010, 07:26 |
|
Registriert: Sonntag 20. Dezember 2009, 15:42
Beiträge: 218
Wohnort: Auf der richtigen Seite ;-)
|
|
@all
Möchte mal zurück zum Thema kommen: Angst was ist das eigentlich?
Nach 30 Jahren therapeutischer Begleitung bei unterschiedlichen Therapeuten, Psychosomo-Klinikaufenthalten und literaturverschlingender Egotherapie, weiß ich es bis heute nicht!
Ich spüre die Angst, wie ich es zulasse, dass sie in mir hochkrabbelt, mir dabei den Brustkorb einschnürt und den Atem nimmt, ja mich am Leben nur im besoffenen Zustand teilnehmen lässt (Wenn das mal eine Teilnahme ist!).
Highlight sind die intensiven Panikattacken. Nach abklingen derselben komme ich mir vor, als hätte ich an einem Marathonlauf teilgenommen, aber ohne Endorphinausschüttung. Nur ausgelaugt, reif für die nächste Flasche.
Es nützt m.E. nicht unbedingt, um meine Situation zu ändern, die Angst wirklich komplett verstehen zu wollen. Mit der Angst umgehen zu lernen, evtl. auch das posttraumatisch Erlebte aufzuarbeiten, scheint mir ein Weg aus Angst, Depression und Sucht.
Übrigens: Kein Therapeut, obwohl ich auch ganz offen meine Sucht und Ängste mitteilte, konnte mich „knacken“. Letztes Aufbäumen der Therapeuten: „Wollen Sie nicht mal über einen Aufenthalt in einer Entzugsklinik nachdenken? „ Sorry, nein danke; damit war für mich die Therapie beendet.
LG
Archi
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
anima
|
Betreff des Beitrags:  Verfasst: Verfasst: Dienstag 23. März 2010, 07:52 |
|
Registriert: Freitag 19. März 2010, 12:20
Beiträge: 119
|
Hallo Archi,
ich glaube, dass das Problem bei der Sache ist, dass man sich tatsächlich nur selber "knacken" kann. Ich habs an anderer Stelle schon mal versucht zu formulieren, wie ich es empfunden habe, als ich mich den Ängsten gestellt habe...für mich war es wie bewußt das Risiko eingehen zu sterben. Ich wollte nicht mehr im Griff der Angst leben. Ich wollte ihre Fressen sehen und in Selbige schlagen. Ich habe mich dann getraut, ihnen ein Gesicht zu geben und eine Gestalt (das im Übrigen ohne therapeutische Hilfe, siehe Vertrauen...) Es hört sich blöd und esotherisch an, ich weiß, aber bei Lichte betrachtet waren die Ängste dann eine nach der anderen nur noch kleine, häßliche, verschrumpelte Misthaufen. Die habe ich dann direkt als Dung für die neue, gute Saat benutzt. Ja, man muss die Traumata aufarbeiten, sich von ihnen trennen (die finden das aber gar nicht witzig und können ganz schön klammern, warscheinlich haben die auch eine Borderlinestörung...  ...Scherz am Rande)
Archi, ich drück Dir die Daumen. Vielleicht hilft Dir die Vorstellung, dass hier einige gute Geister rumschwirren, die Dir im Kampf zur Seite stehen...
:smt027 :smt065 :smt066 :smt063 :smt071
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
emelie
|
Betreff des Beitrags:  Verfasst: Verfasst: Dienstag 23. März 2010, 11:44 |
|
Registriert: Dienstag 2. März 2010, 11:17
Beiträge: 575
|
|
Hallo Archi,
ich kenne diese von Dir beschriebenen Angst- und Panikgefühle. Ich dache einmal während einem Intercontinental Flug über dem Atlantik, ich müsste sterben. Habe eine schlimme Panikattacke bekommen und wollte nur noch raus, hatte das Gefühl, die kriege keine Luft mehr.
Nach einigen harten Drinks ging es mir wieder besser.....
Seither hab ich total Flugangst. Beim Autofahren hatte ich auch einmal eine solche Attacke... mir brach der Schweiss aus, Herzklopfen, schwindlig.... war auf der Autobahn und musste zumindest noch bis zur nächsten Abfahrt kommen. Als ich angehalten habe, hab ich am ganzen Körper gezittert, weiche Knie gehabt!
Natürlich habe ich meine Aengste mit Alk therapiert und es gab eine Zeit, da konnte ich ohne einen gewissen Pegel ( wobei ich nie betrunken gefahren bin) nicht Autofahren. Ebenso in keine Bergbahn/Sessellift gehen.
Ich nehme jetzt seit ca. 6 Monaten Baclofen und meine Angstzustände haben bei der Dosierung von 40-50 mg. pro Tag praktisch aufgehört. Wie es mit der Flugangst ist, hab ich noch nicht ausprobieren können. Ich hoffe, dass ich wieder in der Lage sein werde, ohne Panik in ein Flugzeug zu steigen.
Liebe Grüsse
Emelie
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
Archi
|
Betreff des Beitrags:  Verfasst: Verfasst: Dienstag 23. März 2010, 12:46 |
|
Registriert: Sonntag 20. Dezember 2009, 15:42
Beiträge: 218
Wohnort: Auf der richtigen Seite ;-)
|
|
hi emelie,
Danke für den Bericht Deiner persönlichen Erfahrungen mit der Angst.
Mir geht es fast bei jeder Autofahrt so. Auch in der Bahn, in der Stadt, am Sonntag sogar bei einem Museumsbesuch bekomme ich Panikattacken.
Nun mit Baclofen nehme seit gestern 100 mg/Tag, schwinden die Ängste etwas. Der Alkkonsum geht runter. Ist aber schon mein 2.Versuch mit Bac.
---
hi anima,
danke für die Daumen, kann ich gut gebrauchen.
Wie hast Du Dich Deiner Ängste gestellt? Ist für mich noch immer ein Rätsel wie es gehen mag.
Traumataaufarbeitung: Hast Du da Erfahrungen sammeln können?
Warte mit Spannung auf Deine Antwort. Oder waren meine Fragen jetzt zu persönlich?
LG
Archi
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
Federico
|
Betreff des Beitrags:  Verfasst: Verfasst: Dienstag 23. März 2010, 15:06 |
|
 |
| Gründer † |
 |
Registriert: Freitag 27. November 2009, 17:11
Beiträge: 8253
Wohnort: München
|
|
@alle,
ich will mich jetzt nicht schon wieder outen, zum Thema Angst habe ich etwas beizutragen. ich bin seit Oktober in einer geleiteten SHG Angst & Panik (MASH) in den wöchentlichen Sitzungen. Die bisherigen Erfolge sehe ich weniger in einer Aufarbeitung, mehr im Austausch von konkreten Bewältigungsstrategien. Für mich interessant war die Erkenntnis, dass nahezu bei jedem Mitglied die Ursachen in der frühen Kindheit zu finden waren. Die Palette reicht von Vernachlässigung, Ablehnung, seelischer und körperlicher Gewalt bis hin zum sexuellenm Missbrauch.
Alle sind sich in der Bewertung einig, dass die Vergangenheit zwar wichtig ist, die konkrete Erfahrung durch die Spiegelung mit den anderen Betroffenen am hilfreichsten für die Bewältigung und Überwindung der Störungen ist.
Ich bin der einzige unter den Betroffenen der das Medikament Alkohol zur Angstunterdrückung verwendet hat. Alle anderen haben konkrete langjährige Erfahrung mit AD´s aller Coleur und natürlich Benzos. Ich kann meine postive Erfahrung mit MASH (googelt mal nach Angst+DASH) nur wärmstens empfehlen, zumal die Kosten mit pro Monat € 20,– wirklich moderat sind. Wer mehr wisen möchte kann mich gerne per PM anfunken.
LG
Federico
_________________
„Es gibt keine Alternative zum Optimismus,
Pessimismus ist Lebensfeigheit.“ Richard David Precht
|
|
| Nach oben |
|
 |
Wer ist online? |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste |
|
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
|


|


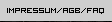



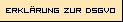





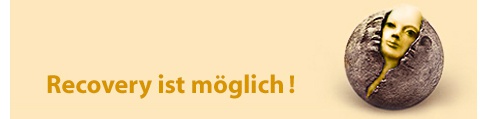
 ...Scherz am Rande)
...Scherz am Rande)

